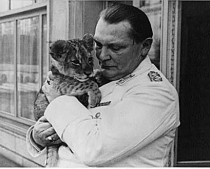Nazi-Zoos
Die deutschen Tiergärten zwischen 1933 und 1945
Die 1793 eröffnete Ménagerie im Jardin des Plantes von Paris gilt als erster Zoo „moderner“ Prägung. Bestückt mit übriggebliebenen Tieren aus der königlichen Tiersammlung im Schlosspark von Versailles diente sie als Modell für eine Vielzahl weiterer Zoogründungen in ganz Europa. Auch der Mitte des 16. Jahrhunderts schon begründete Tiergarten im Schlosspark von Schönbrunn bei Wien wurde entsprechend umgestaltet und der Öffentlichkeit zugängig gemacht; er existiert als älteste Tiersammlung der Welt bis heute.
Ab den 1820er Jahren formierte sich in England eine ganze Reihe bürgerlicher Zoogesellschaften mit dem Ziel, eigene zoologische Einrichtungen zu etablieren. Im Gegensatz zu den fürstlichen Tiersammlungen und Ménagerien des 16. bis 18. Jahrhunderts sollten diese Einrichtungen naturwissenschaftlicher Forschung und Lehre verschrieben sein. Der erste dieser Zoos wurde 1828 in London begründet, gefolgt kurz darauf von Zoos in Dublin 1831, Bristol 1835, Manchester 1837, Edinburgh 1839 und Leeds 1840.
1838 öffnete in Amsterdam der erste nicht-britische Zoo (abgesehen vom Pariser Jardin des Plantes und dem Tiergarten Schönbrunn) seine Tore, 1843 der Zoo Antwerpen und 1844 als erster bürgerlicher, wenngleich von der Gunst des preußischen Königshauses abhängiger Tiergarten Deutschlands der Zoo Berlin. Weitere Zoogründungen folgten in Frankfurt am Main 1858, Köln 1860, Dresden 1861, Hamburg 1863, Hannover 1865 und Karlsruhe 1865. Bis zur Jahrhundertwende wurden in ganz Europa - vornehmlich in Ländern, die als Kolonialmächte unbegrenzten Zugriff auf Nachschub an Wildtieren hatten (d.h. in Russland, Frankreich, Dänemark, Portugal, Spanien, den Niederlanden, ab 1871 auch im Deutschen Kaiserreich) - nicht weniger als dreißig weitere Großzoos etabliert; zu den bereits bestehenden deutschen Einrichtungen, die ihren Bestand an exotischen Tieren bis dahin über Handelsbeziehungen bzw. eine regelmäßig im Zoo Antwerpen stattfindende Tierversteigerungsbörse aufgebaut hatten, kamen vier weitere hinzu (Münster 1874, Leipzig 1878, Wuppertal 1881, Rostock 1899). Außerhalb Europas gab es nur sehr vereinzelt Zoogründungen, die meisten davon entstanden in den Kolonialländern selbst, aus denen die Wildtiere für die europäischen Zoos bezogen wurden und dienten insofern als Sammel- und Umschlagplätze (Melbourne, 1862, Djakarta 1864, Hongkong 1871, Kalkutta 1875, Kairo 1891, Pretoria 1898). Eine ähnliche Zoogründungswelle wie in Europa gab es nur in den (von europäischen Einwanderern dominierten) USA, wo zwischen 1855 und 1899 vierzehn Großzoos und ungezählte kleinere Einrichtungen entstanden. (1)
Nach der Jahrhundertwende setzten sich die Zoogründungen vor allem im Deutschen Reich nahtlos fort: allein bis zu Beginn des Ersten Weltkrieges wurden fünf weitere Großzoos eingerichtet (Halle 1901, Landau i.d. Pfalz 1904, Hamburg 1907, München 1911, Nürnberg 1912), daneben, wie auch schon im ausgehenden 19. Jahrhundert, eine Vielzahl kleinerer Tiergärten, Schaugehege und Aquarien.
Mit Ausbruch des Krieges kollabierte das bis dahin prosperierende Tiergartenwesen nachgerade schlagartig. Aufgrund der ausbleibenden Besucher gerieten viele nach kürzester Zeit an den Rand des Ruins. Hinzu kamen Versorgungsengpässe bei Fleisch und Getreide, so dass zahllose Zootiere an Mangelernährung starben; viele wurden auch geschlachtet und an andere Tiere verfüttert bzw. an Fleischhändler verkauft. Die leerstehenden Gehegehäuser wurden nicht mehr instandgehalten, die Attraktivität der Zoos sank auf den Nullpunkt.
Auch nach dem Krieg übten die mühsam wieder in Gang gesetzten Zoos nur wenig Anziehungskraft aus; ganz abgesehen davon, dass die Hyperinflation in den Anfangsjahren der Weimarer Republik den Menschen kaum die Möglichkeit gab, sich irgendwelche Freizeitvergnügungen leisten zu können.
Viele der bis zum Ersten Weltkrieg von Aktiengesellschaften oder privaten Träger- vereinen betriebenen Zoos konnten nur dadurch über Wasser gehalten werden, dass sie in kommunale Trägerschaft überführt und aus öffentlichen Mitteln bezuschusst wurden; einige, wie etwa der Zoo Hannover, gingen trotzdem pleite. Auch dem Frankfurter Zoo drohte die Schließung. Obgleich die Stadt, die schon 1915 die Trägerschaft übernommen hatte, erhebliche Steuermittel in den Erhalt des Zoos pumpte und diesen mit allerlei Neuerungen versah, mithin einer eigenen Kinematographenbühne oder kostenfreiem Ausschank von Frischmilch, blieben die Besucherzahlen weit hinter den Erfordernissen für einen einigermaßen wirtschaftlichen Betrieb zurück.
Auch andernorts lief es nicht besser. Gleichwohl ab 1924, vor allem über Handels- beziehungen der Firma Hagenbeck, wieder exotische Wildtiere aus dem Ausland bezogen werden konnten, gelang es nur schleppend, wenn überhaupt, die alte Attraktivität wiederherzustellen. In vielen Zoos versuchte man, über Rummelplatz- attraktionen - Achterbahnen, Krinolinen, Kasperletheater oder Schießbuden - Besucher zurückzugewinnen. Auch Zirkusshows wurden veranstaltet, bei denen Seelöwen, Tiger, Elefanten und andere Wildtiere andressierte „Kunststücke“ zeigen mussten.(2) Im Berliner Zoo etwa mußten Schimpansenkinder mit Tellern, Tassen und einer großen Kaffeekanne hantieren und dabei antrainierte Slapsticks vorführen. Einer der Dresdner Schimpansen wurde in einen bayerischen Trachtenanzug gesteckt und mußte zum Vergnügen der Besucher Fahrradfahren oder auf einer Geige spielen. Trotz all solcher Anstrengungen kamen die Zoos indes nicht mehr richtig auf die Beine.
Tierhag
Erst ab 1933 ging es wieder aufwärts. Großzügig gefördert durch die neuen Machthaber konnten heruntergekommene Anlagen instandgesetzt bzw. durch Neubauten ersetzt werden. In zahlreichen Städten
wurden mit finanzieller und propagandistischer Unterstützung der Nationalsozialisten neue Zoos eingerichtet, 1936 etwa - „im dritten Jahre der nationalen Erhebung unter der Führung Adolf Hitlers“,(3)
wie es in einer hakenkreuzverzierten Gründungsurkunde hieß - der Zoo Osnabrück, für den „Reichsjägermeister“ Hermann Göring sich persönlich verwandte; auch der im Jahr darauf eröffnete Zoo Augsburg
erfuhr Förderung von höchster Stelle: der seinerzeitige bayerische Ministerpräsident Ludwig Siebert (NSDAP) setzte sich nachdrücklich für den zeitgeistig als „Tierhag“ bezeichneten Zoo ein. Sämtliche
Zooneugründungen der 1930er – Bochum 1933, Duisburg 1934, Heidelberg 1934, Ulm 1935, Rheine 1937, Straubing 1937 oder Krefeld 1938 – wurden entweder von NS-Funktionären initiiert oder von ihnen nach
Kräften unterstützt und vorangetrieben.
Am deutlichsten wird der Stellenwert, den die Nazis der Einrichtung „Zoo“ zumassen, im Blick auf die Umsiedelung des seit 1912 schon bestehenden Nürnberger Tiergartens, der der geplanten Erweiterung des Reichsparteitags- geländes weichen musste. Bezuschusst mit der damals ungeheueren Summe von 4,3 Millionen Reichsmark wurde der Zoo ab 1937 auf einem vielfach größeren Areal etwas außerhalb der Stadt neu angelegt (zum Vergleich: das Monatseinkommen eines Facharbeiters lag bei durchschnittlich 172 RM). Die Gehege-, Betriebs- und Verwaltungsbauten wurden ganz im Stil der völkischen „Heimatschutzarchitektur“ errichtet, wie die Nazis sie auch für ihre Siedlungsbauten bevorzugten. Nürnbergs NSDAP-Oberbürgermeister Willy Liebel, SA-Mann der ersten Stunde und späterer Mitarbeiter Albert Speers, überwachte die Baumaßnahmen höchstpersönlich. Als Bauleiter fungierte NS-Architekt Walter Brugmann. Der Eröffnung am 5. Mai 1939 wohnte jede Menge Nazi-Prominenz bei, die sich von dem neugestalteten Zoo hellauf begeistert zeigte. Hitler, der schon ein paar Tage zuvor einen Privatrundgang unternommen hatte, soll , wie die Presse berichtete, den Zoo als „schönsten Tiergarten Deutschlands“ belobigt haben.(4)
Zoodynastie Heck
Ein bezeichnendes Licht auf das Verhältnis des Nationalsozialismus zur Institution „Zoo“ wirft auch die Geschichte der Zoodynastie Heck: Der seit 1931 als Direktor des Berliner Zoos firmierende Lutz
Heck (1892-1983) war schon 1933 offizielles „Fördermitglied der SS“ geworden, 1937 trat er der NSDAP bei. Er stand in engem freundschaftlichem Kontakt zu Göring, mit dem er seine Leidenschaft
für Großwildjagd teilte. Tatsächlich ging er bei Göring ein und aus, immer wieder war er auch auf dessen Reichsjägerhof in der Rominter Heide zu Gast. Die pseudowissenschaftlichen Experimente, die er
zur „Rückzüchtung“ von Auerochsen und Wisenten betrieb, wurden von Göring höchstpersönlich gefördert. 1938 erhielt Heck anläßlich des „Führergeburtstages“ den Titel eines Professors verliehen, zwei
Jahre später wurde er, zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Zoodirektor, zum Leiter der Obersten NS-Naturschutzbehörde ernannt. Im selben Jahr erhielt er von der Preußischen Akademie der Wissenschaften
die silberne Leibniz-Medaille für seine „wissen-schaftliche und volksbildende“ Tätigkeit zuerkannt, gefolgt von zahlreichen weiteren Ehrungen und Preisen des NS-Staates.(5)
Göring sorgte auch dafür, dass der Berliner Zoo 1935 eine reich bemessene Geländeschenkung aus preußischem Staatsbesitz erhielt, die es Heck erlaubte, angrenzend an die bestehenden Anlagen einen eigenständigen „Deutschen Zoo“ einzurichten. In künstlich geschaffenen Felsgehegen wurden Bären, Wölfe und andere „deutsche“ Tiere untergebracht, mithin Füchse, Wildkatzen und Luchse; dazu gab es ein Biber- und Fischotterbecken sowie Volieren für Auer- und Birkhühner. An einigen der Gehege wurden zur Verdeutlichung des Deutschtums der darin gezeigten Tiere eigens kleine Hakenkreuze angebracht. Auch in anderen Zoos wurden „Hegestätten deutscher Tierwelt“ eingerichtet.(6)
Die Idee eines „Deutschen Zoos“ hatte bereits Ludwig Heck (1860-1951) verfolgt, Vater von Lutz Heck, der als Amtsvorgänger seines Sohnes dreiundvierzig Jahre lang [!] den Berliner Zoo geleitet hatte. Finanziert von Wilhelm II. hatte er schon um die Jahrhundertwende eine „vaterländische Sammlung“ angelegt, in der Raubtiere, Eulen und Greifvögel aus „deutschen Landen“ gezeigt wurden; die „deutschen“ Tiere waren allerdings über das ganze Zoogelände verteilt gewesen, erst Mitte der 1930er wurden sie in einem eigenständigen Bereich zusammengefasst. Auch Ludwig Heck war überzeugter Nazi. In seiner 1938 vorgelegten Autobiographie rühmte er sich, schon Nationalsozialist gewesen zu sein lange bevor man das Wort überhaupt erfunden habe.(7) Anlässlich seines 80. Geburtstages wurde er vom „Führer“ höchstpersönlich mit der „Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft“, der höchsten „Kulturauszeichnung“ des NS-Staates, geehrt.
Auch Ludwig Hecks zweiter Sohn Heinz (1894-1982) war Zoodirektor, und auch er war eng in das NS-Regime verstrickt. Ab 1928 leitete er den Münchner Tierpark Hellabrunn, in dem er sich, ebenso wie sein Bruder Lutz in Berlin, mit der „Rückzüchtung“ von Auer-ochsen, Wisenten und Wildpferden befasste; auch seine pseudowissenschaftlichen Zuchtversuche wurden von „Reichsjägermeister“ Göring mit großzügigen Fördermitteln ausgestattet.
Nach dem Krieg wurden Lutz und Heinz Heck aus dem Verband Deutscher Zoodirektoren ausgeschlossen.(8) Auf der Website des VDZ findet sich dafür folgende Erklärung: „Geheimrat [Ludwig] Heck und seine beiden Söhne [=Lutz und Heinz Heck] haben sich um die von ihnen geleiteten Zoos unbestreitbar große Verdienste geschaffen und deren Entwicklung nachhaltig beeinflusst. Bei ihrer Würdigung darf aber nicht verschwiegen werden, dass ihre Beziehung zu Ideologie und Führerschaft des Dritten Reiches eine Form hatte, die weit hinausging über Mitläuferschaft und bloßes deutsch-nationales Denken, wie es auch bei anderen Zoodirektoren aus jener Zeit festgestellt werden kann. Vielmehr stellten sich Vater und Söhne aktiv in den Dienst der nationalsozialistischen Ideologie, die Söhne als Mitglieder der NSDAP und Fördermitglieder der SS. (…) Zudem unterhielt die Familie Heck freundschaftliche Beziehungen zu Personen der obersten Führungsetage des Dritten Reiches.“(9) Mit Blick auf Heinz Heck wird in einem Jubiläumsband zum 100jährigen Bestehen des Tierparks Hellabrunn im Jahre 2011 das genaue Gegenteil behauptet: „Heinz Heck war der einzige deutsche Zoodirektor, der bis zuletzt nicht Mitglied der NSDAP wurde. Es gelang ihm sogar, den Tierpark Hellabrunn weitestgehend aus Verwicklungen mit dem nationalsozialistischen Regime herauszuhalten.“ Und dies, obgleich die „Nationalsozialisten dem Tierpark mit größtem Interesse“ begegneten, ließen sich doch „Hecks Tierzuchtprogramme wie die Rückzüchtung von Auerochsen gut mit der herrschenden Rassenideologie vereinbaren“. Allenfalls seien Hecks Zuchtprogramme von den Nazis „instrumentalisiert“ worden, wie sie den Münchner Tierpark insge-samt zu einer „bedeutenden Institution der neuen deutschen Wissenschaft stilisiert“ hätten. Heck selbst sei, wie die weit überwiegende Mehrzahl seiner Untergebenen, in „keiner nationalsozialistischen Organisation tätig“ gewesen.(10) Nachweislich jedenfalls war Heinz Heck an einem Projekt der „Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe“ beteiligt, einer 1935 von „Reichsführer SS“ Heinrich Himmler begründeten Einrichtung, deren Gesamtzweck darin lag, die NS-Rassenideologie „wissenschaftlich“ zu unterfüttern.(11)
NS-Biologie und vorgeblicher Tierschutz
Tatsächlich eigneten sich die Tiergärten hervorragend als NS-Propagandainstrumente: sie dienten als Stätten „darstellender Biologie“, in denen zentrale ideologische Themen des NS-Staates wie
Vererbungslehre oder Rassenkunde anschaulich gemacht werden konnten. Die Verbreitung und Festigung „biologischen Gedankenguts“ galt als „Kernstück der deutschen Volksbildung“.(12) Hinzu kam, dass die
Gehegeabteilungen mit „deutschen“ Tieren zur Stärkung vaterländischer Volksgesinnung beitragen sollten.(13) Mit „exotischen“ Tieren konnte überdies Propaganda für die Wiedergewinnung der ehemaligen
deutschen Kolonien gemacht werden, wozu auch eine NSDAP-geförderte „Deutsche Afrika-Schau“ diente, die nach dem Vorbild der Hagenbeckschen „Völkerschauen“ ab 1935 durch die Lande tourte.(14)
Auch Tierschutz spielte eine wesentliche Rolle in der verlautbarten Werteordnung des Nationalsozialismus. Mit Tierschutzpropaganda konnte man populistisch geschickt anknüpfen an eine seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert schon sich entwickelnde und in hunderten von Vereinen organisierte Hinwendung zu Natur- und Tierschutz in breiten Teilen der Bevölkerung. Mit der Vereinnahmung der Idee samt nachfolgender Gleichschaltung der zahllosen Tierschutz- und Antivivisektions- vereine konnte zudem einer schwelenden Protestbewegung der Boden entzogen werden. In der Tat fand der Tierschutzgedanke schon unmittelbar nach der sogenannten Machtergreifung Niederschlag in den ersten erlassenen NS-Gesetzen: Schon im April 1933 wurde das Schlachten warmblütiger Tiere ohne Betäubung verboten, kurze Zeit darauf wurde das Strafmaß für Tierquälerei erheblich verschärft: die Nazis rühmten sich insofern der “besten Tierschutzgesetzgebung der Welt“.(15) In Wirklichkeit aber war die NS-Novellierung der Weimarer Gesetze weniger von tierethischen Motiven getragen, als vielmehr von der Absicht, damit ein Druck- und Sanktionsmittel gegen die jüdische Bevölkerung in die Hand zu bekommen: das Verbot, Schlachttiere ohne Betäubung zu töten, stellte das jüdisch-orthodoxe Schächten unter Strafe.(16)
Die NS-Prominenz gab sich betont tierfreundlich: Hitler etwa ließ sich gerne mit seinen Hunden ablichten, auch Kitschpostkarten, auf denen er Rehkitze tätschelt, waren weitverbreitet; desgleichen der Mythos, er ernähre sich rein vegetarisch. Selbst Göring als passionierter Jäger oder Himmler, der vor seiner Karriere in der SS eine Hühnermastanstalt vor den Toren Münchens betrieben hatte, stellten sich als engagierte Tierschützer dar; Göring vor allem als Gönner und Förderer zoologischer Gärten. Die Zoos in Berlin und Dresden wurden unter seiner Schirmherrschaft weitläufig ausgebaut; aber auch kleinere Zoos wurden von ihm begünstigt: dem Heimattiergarten Neunkirchen etwa schenkte er einen seiner privat gehaltenen Löwen. Auch Hitler selbst gerierte sich als Tiergartenfreund: den Münchner Tierpark Hellabrunn etwa beschenkte er mit fünfzig Mandarinenten und zwei Giraffen.
Auch nach Kriegsbeginn 1939 blieben die Zoos weiterhin gut besucht: die fortdauernde Propaganda der Nazis sorgte dafür, dass der sonntägliche Familienausflug in den Zoo zum unverzichtbaren Teil deutscher Alltagskultur wurde. In vielen Zoos gab es Sonderkonditionen für Wehrmachtsangehörige auf Heimaturlaub. Auch von Versorgungsengpässen wie zu Beginn des Ersten Weltkrieges blieben die Zoos weitgehend verschont.
Mit den flächendeckenden Bombardements deutscher Großstädte ab Frühjahr 1942 änderte sich das Bild schlagartig: viele der Zoos wurden schwer beschädigt, einige davon - Frankfurt, Münster, Dresden - wurden praktisch dem Erdboden gleichgemacht. Da auf Anweisung Görings der Zoobetrieb bis zuletzt hatte aufrechterhalten werden müssen - viele Zoos waren bis Ende 1944 geöffnet -, waren nur wenige Tiere ausgelagert worden: zigtausende von Zootieren kamen bei den Bombenangriffen zu Tode. Im Berliner Zoo, der zu den tier- und artenreichsten Zoos Welt gezählt hatte, überlebten nur ein paar Dutzend. Vielerorts wurden überlebende Tiere auf behördliche Anweisung hin erschossen oder fielen Plünderungen zum Opfer.
Verdrängen und Vertuschen
Eine wirkliche Aufarbeitung der Verstrickung der deutschen Zoos in den Nationalsozialismus wurde bis heute nicht vorgenommen. In den Verlautbarungen heutiger Zoos und Zooverbände wird die Geschichte
zwischen 1933 und 1945 entweder komplett verschwiegen oder aber abgestritten, kaschiert, verharmlost und beschönigt. In einer bis heute für den Zoounterricht verwendeten Materialsammlung des
Verbandes deutschsprachiger Zoopädagogen e.V. aus dem Jahr 2001 heißt es: „Während der nationalsozialistischen Herrschaft machten die deutschen Zoos keinerlei Fortschritte. (...) Die Nazis -
vielleicht mit Ausnahme Hermann Görings - interessierten sich nicht für Zoos.“(17)
Unter dem Titel „Gebaut unter Hitler und doch kein Nazi-Zoo“ vermerkt der hauseigene Geschichtsschreiber des Nürnberger Tier-gartens, es sei das „Interesse der Parteispitze [der NSDAP] am damals größten deutschen Tiergarten eher gering“ gewesen.(18) Bei der Einweihung am 5. Mai 1939 habe „die oberste Führung aus Berlin durch Abwesenheit“ geglänzt, wie überhaupt die „Nazis offenbar wenig Interesse an zoologischen Gärten“ gehabt hätten. Belegt wird diese Auffassung mit dem Hinweis darauf, dass das Titelbild des zur Eröffnung vorgelegten „Tiergarten-Führers“ einen „überlebensgroßen Orang-Utan“ zeige; zudem seien „drei (exotische) Flamingos zu sehen und ein Wisent oder Bison, der auf der Wiese steht. Da im Text ausdrücklich erwähnt wird, dass der Europäische Wisent im Gegensatz zum Amerikanischen Bison ein Waldtier ist, dürfte auf dem Cover keine ‚einheimische‘ Tierart abgebildet sein. Auch unterbleibt in der Publikation jede sprachliche Germanisierung der mitteleuropäischen Fauna“. Im Übrigen seien auf der Einladungskarte zur „Eröffnung des neuen Tiergartens (…) keine Parteisymbole“ aufgedruckt gewesen.(19)
Das Verdrängen und Vertuschen hat System: Noch bis fast sechzig Jahre nach Kriegsende weigerte sich etwa der Zoo Berlin zuzugeben, dass nach der „Machtergreifung“ der Nazis jüdische Zoo-Aktionäre gezwungen worden waren, ihre Anteile zu Spottpreisen zu veräußern; desgleichen, dass ab 1939 Juden der Zutritt zum Berliner Zoo verboten worden war. In einer Studie des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin von 2002 wurde nachgewiesen, dass „die Zooleitung den Ausschluß der Juden in allen Bereichen mit eigenständigen Initiativen betrieben hatte und im vorauseilenden Gehorsam mit allen Maßnahmen den nationalsozialistischen Sondergesetzen zuvorgekommen war.“(20) Auch andere Zoos durften von Juden nicht mehr betreten werden.
Die Direktoren und Verwaltungsräte der deutschen Großzoos standen den Nazis durchwegs höchst wohlwollend gegenüber. Soweit rekonstruierbar gehörten sie spätestens seit 1937 ausnahmslos der NSDAP und/oder sonstigen Gliederungen des NS-Staates an, viele in hochrangigen Funktionen. Im Vorstand des Aktienvereins des Berliner Zoos beispielsweise saß seit 1936 der Generalleutnant der Waffen-SS Ewald von Massow; der Heidelberger Zoo war überhaupt erst mit Geldern des NSDAP-Förderers und späteren NS-Wehrwirtschaftsführers Carl Bosch begründet worden. Auch der Dresdner Zoodirektor und Zoologieprofessor Gustav Brandes bekannte sich offensiv zu den Nationalsozialisten: wie selbstverständlich zählte er zu den Unterzeichnern des „Bekenntnis(ses) der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat“ vom 11. November 1933.(21)
Nach dem Krieg blieb die Mehrzahl der NS-belasteten Zoodirektoren unbeanstandet im Amt. Bei einigen wurde eine kurze Schamfrist eingelegt, dann wurden sie erneut in ihre alten Positionen berufen. Der Zoologe Karl Max Schneider etwa, seit 1934 Direktor des Leipziger Zoos, wurde seiner NSDAP-Mitgliedschaft wegen 1945 entlassen, im Jahr darauf aber anstandslos wieder eingestellt. 1952 erhielt er überdies eine Professur an der Leipziger Universität, zeit-gleich wurde er zum Präsidenten des Verbandes Deutscher Zoodirek-toren gewählt. Eine ähnliche Karriere legte sein langjähriger Stellvertreter Heinrich Dathe hin: 1932 bereits der NSDAP beigetreten, musste er 1945 seinen Posten im Zoo räumen, wurde aber bald darauf erneut berufen; zugleich bekam er einen Lehrauftrag, später sogar eine Professur, an der Universität Leipzig. Ab 1954 baute er im Auftrag des Staatsrates der DDR den Tierpark (Ost-)Berlin auf, den er, hochehrengeachtet, bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1990 leitete. Bezeichnend ist auch die Karriere des Veterinärmediziners Friedrich Schmidt-Hoensdorf, der seit 1929 den Zoo Halle geleitet hatte: trotz langjähriger Mitgliedschaft in der NSDAP, im SS-Reitersturm und in anderen NS-Gliederungen erhielt er nach dem Krieg problemfrei eine Professur an der FU Berlin; von 1954 bis zu seinem Tod 1967 gehörte er unbeanstandet auch dem Aufsichtsrat des Zoologischen Gartens Berlin an.
In den Annalen der jeweiligen Zoos bleiben die NSDAP-Mit-gliedschaften der seinerzeitigen Direktoren, Verwaltungsräte und Geldgeber bis auf wenige Ausnahmen unerwähnt. Bis heute sind sowohl nach Schneider als auch nach Dathe öffentliche Schulen benannt, desgleichen nach Ludwig Heck, Carl Bosch und anderen der NS-Ideologie verbundene und/oder dienstbare Persönlichkeiten. Zu Ehren Ludwig Hecks erschien 1957 eine Sonderbriefmarke, zu Ehren seines Sohnes Lutz stellte man 1984 eine Bronzebüste im Berliner Zoo auf, die heute noch dort steht. Auch innerhalb des Verbandes Deutscher Zoodirektoren ist die Heck-Dynastie längst wieder salonfähig: In einem Jubiläumsband zum 125jährigen Bestehen des Verbandes aus dem Jahre 2012 werden alle drei Hecks als „berühmte Tiergärtner“ gewürdigt, die, obgleich eng mit dem Nationalsozialismus verbunden, doch Großes für das Zoowesen geleistet hätten.(22) Dass es dem Verband kurz nach dem Krieg opportun erschienen war, demonstrativ auf Abstand zu den Hecks zu gehen, deren persönliche Nähe zu den braunen Machthabern schlechterdings nicht zu leugnen gewesen war, erlaubt es ihm bis heute, mit Verweis auf ebendiese Distanzierung einen kritischen Umgang mit der eigenen Geschichte vorzugaukeln und damit die Verflechtung des gesamten deutschen Zoowesens in das NS-Regime zu verschleiern. Weitere Auseinandersetzung des VDZ mit seiner und der Rolle der deutschen Zoos zwischen 1933 und 1945 – über den Umstand hinaus, dass man den tümelnden Verbandsnamen im Sommer 2014 in Verband der Zoologischen Gärten e.V. abänderte – gibt es erkennbar nicht.(23)
Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle der Säulenheilige aller Zoo-Zoologie, Bernhard Grzimek (1909-1987), der ab 1945 den Frankfurter Zoo leitete. Grzimek war 1933 der SA und 1937 der NSDAP beigetreten; von 1938 bis Kriegsende war er als Regierungsrat im NS-Reichsernährungsministerium tätig. Auch wenn er seine Verstrickung in den Machtapparat der Nationalsozialisten zeitlebens verschwieg bzw. abstritt, gilt diese doch als erwiesen.(24) Selbstredend wird auch er in der VDZ-Ehrenriege als „berühmter Tiergärtner“ geführt, der, obgleich „seit 1937 NSDAP-Mitglied gewesen, sich aber nie im Sinne der Partei betätigt“ habe.(25) Verdrängung und Vertuschung bis heute. □
Colin Goldner
Tierstudien 7, 1/2015
(1) Eric Baratay/Elisabeth Hardouin-Fugier: Zoo. Von der Menagerie zum Tier-park. Berlin: Wagenbach 2000.
(2) Sebastian Gleixner: Weltkrieg und Ende auf Widerruf 1914-1923. Der Tierpark in schweren Zeiten. In: Michael Kamp/Helmut Zedelmaier (Hrsg.): Nilpferde an der Isar. Die Geschichte des Tierparks
Hellabrunn in München. München: Buchendorfer Verlag 2000, S. 88-111.
(3) Andreas Budemann (Hrsg.) 75 Jahre Osnabrück. Das Geburtstagsmagazin 2011. Osnabrück: E.i.S. 2011, S.7. Die hakenkreuzverzierte „Urkunde über die Grundsteinlegung zum Heimat-Tiergarten in
Osnabrück“ vom 19. September 1935 ist in einer Größe von 40x48 mm nur mit Lupe zu entziffern.
(4) Hartmut Voigt: Der Tiergarten feiert am Samstag seinen Geburtstag. www.nordbayern.de/freizeit/tiergarten/der-tiergarten-feiert-am-samstag-seinen-geburtstag-1.2058720 (Zugriff am
28.10.2014).
(5) Kai Artinger: Der "Vater der Rominter Ure“. Bemerkungen zum wissenschaftlichen Leiter des Berliner Zoos im Nationalsozialismus. www.diegeschichte
berlins.de/geschichteberlins/persoenlichkeiten/persoenlichkeitenhn/491-heck.html?573da0f5e1c688030bddf01b36b05e41=eb10d53492a9becf671fbc09f5227005 (Zugriff am 28.08.2014).
(6) ebd.
(7) Ludwig Heck: Heiter-ernste Lebensbeichte. Erinnerungen eines alten Tier-
gärtners. Berlin: Deutscher Verlag 1938, S.373 (Im Original heißt es: "Meine Söhne haben mir neuerdings öfter gesagt: ,Du warst schon Nationalsozialist, du hast uns schon nationalsozialistische
Weltanschauung gepredigt, lange ehe das Wort erfunden war.' Das ist richtig;...").
(8) Der Spiegel: Berliner Zoo. Urmacher unerwünscht. www.spiegel.de/spiegel/ print/d-28956824.html (Zugriff am 30.11.2014).
(9) Verband Deutscher Zoodirektoren: Die Heck-Dynastie. www.hyperworx.de/zoodirektoren/staticsite/staticsite.php%3Fmenuid=131&topmenu=20&keepmenu=inactive.html (Zugriff am 10.04.2013).
(10) Helmut Zedelmaier/Michael Kamp: Hellabrunn. Geschichte und Geschichten des Münchner Tierparks. München: Bassermann-Verlag, 2011, S.80-81.
(11) Kai Artinger: Der "Vater der Rominter Ure“. Bemerkungen zum wissenschaft-lichen Leiter des Berliner Zoos im Nationalsozialismus. www.diegeschichte
berlins.de/geschichteberlins/persoenlichkeiten/persoenlichkeitenhn/491-heck.html?573da0f5e1c688030bddf01b36b05e41=eb10d53492a9becf671fbc09f5227005 (Zugriff am 28.08.2014).
(12) Änne Bäumer: NS-Biologie. Stuttgart: S.Hirzel Verlag, S.113-122.
(13) Kai Artinger: Der "Vater der Rominter Ure“. Bemerkungen zum wissenschaft-lichen Leiter des Berliner Zoos im Nationalsozialismus. www.diegeschichte
berlins.de/geschichteberlins/persoenlichkeiten/persoenlichkeitenhn/491-heck.html?573da0f5e1c688030bddf01b36b05e41=eb10d53492a9becf671fbc09f5227005 (Zugriff am 28.08.2014).
(14) Susann Lewerenz: Die Deutsche Afrika-Schau (1935-1940). Rassismus, Kolonialrevisionismus und postkoloniale Auseinandersetzungen im nationalsozialistischen Deutschland. Frankfurt am Main:
Peter Lang Verlag, 2006.
(15) Michael Schimanskis: Im Dritten Reich darf es keiune Tierquälerei mehr geben. Die Entstehung des Reichstierschutzgesetzes von 1933. In: Deutsche Tierärztliche Wochenschrift 116,4 (2009)
S.137-147.
(16) Der Spiegel: Nazis und Tierschutz. Tierliebe Menschenfeinde. www.spiegel.de/einestages/nazis-und-tierschutz-a-947808.html (Zugriff am 30.11.2014).
(17) Verband deutschsprachiger Zoopädagogen e.V. (Hrsg): Zoos zwischen den Fronten. Die Widersprüche von Natur- und Tierschutz. Materialien für den fächerübergreifenden Unterricht.
www.vzp.de/PDFs/Frontendownload.pdf (Zugriff am 18.12.2013).
(18) Mathias Orgeldinger: Exotische Tiere in inszenierter altfränkischer Landschaft – Planung und Bau des neuen Tiergartens Nürnberg (1936-1939).
www.cgl.uni-hannover.de/fileadmin/cgl/pdf/Publikationen/Broschueren/Jaegerzaun_Groessenwahn_gesamt.pdf (Zugriff am 28.11.2014).
(19) Mathias Orgeldinger: Gebaut unter Hitler und doch kein Nazi-Zoo. Der Tiergarten am Schmausenbuck. In: Manati - Magazin des Vereins der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V. und des Tiergartens
der Stadt Nürnberg. 27. Jahrgang, Heft 2, November 2012, S.13-14.
(20) Juliane Wetzel: Die Verdrängung der jüdischen Aktionäre aus dem Berliner Zoo. www.tu-berlin.de/fileadmin/i65/Newsletter/news-02-11.pdf (Zugriff am 30.11.2013).
(21) Deutsch Nachrichten: Gustav Brandes. www.deutsch-nachrichten.de/ gustav_brandes (Zugriff 18.11.2013).
(22) Verband Deutscher Zoodirektoren (Hrsg.): Gärten für Tiere: Erlebnisse für Menschen. Köln: J.P.Bachem-Verlag, 2012, S.36-38.
(23) Verband der Zoologischen Gärten e.V.: Wir über uns. www.zoodirektoren.de/ index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=66&Itemid=123 (Zugriff am
05.01.2015).
(24) Claudia Sewig: Bernhard Grzimek. Der Mann der die Tiere liebte. Bergisch-Gladbach: Bastei-Lübbe, 2009.
(25) Verband Deutscher Zoodirektoren (Hrsg.): Gärten für Tiere: Erlebnisse für Menschen. Köln: J.P.Bachem-Verlag, 2012, S.36.